Sehr geehrte Frau Németh,
anbei ein paar Zeilen über die Heimarbeit in der Schirmfabrik Adorf. Von 7-12 Uhr wurden in der Abteilung Heimarbeit die Bezüge für ca. 30 Arbeiter zum Nähen zurechtgemacht. 13 Uhr wurde dann die Ware zu den Heimarbeitern nach Adorf, Jahnsdorf, Neukirchen, Klaffenbach und Chemnitz gefahren und die fertig genähten Bezüge wieder mitgenommen. Früh wurde dann alles kontrolliert und schlecht genähte Bezüge gingen als Nacharbeit zurück. Einmal in der Woche Mittwoch kam ein Fahrer aus Schwarzbach (Thür.), der für 30 Arbeiter Bezüge zum Nähen abholte. Die Arbeiter aus Schwarzbach wurden als erste arbeitslos und danach auch alle anderen Heimarbeiter. Dies ist alles, was ich über die Heimarbeit berichten kann.
Mit freundlichen Grüßen
R. M., Adorf 11.02.2020
Auf dem Weg ins Atelier begegne ich einer Frau, deren Beutel ich fotografieren darf. Sie erzählt, dass sie als junge Frau in Heimarbeit für die Schirmfabrik genäht hat. Eine große Interlognähmaschine stand vor 56 Jahren in ihrer Küche. Sie betreute ihre Zwillinge zu Hause und konnte so dazu verdienen.
Im Gespräch mit Frau Stritzke erfuhr ich bereits einiges über Heimarbeit. Meist waren es Näherinnen, die sich, wenn sie Kinder bekamen, für Heimarbeit entschieden. Bis zum Ende des ersten Lebensjahres des Kindes blieb die Betriebszugehörigkeit erhalten, man erhielt eine unbezahlte Freistellung.
Wer es halbwegs mit dem Platz stellen konnte, bekam die Nähmaschine mit nach Hause. Zweimal in der Woche kam ein Fahrer und belieferte die Frauen mit Säcken voll Ware, die zuvor in der Abteilung Heimarbeit zurechtgemacht wurden.
Auch bei den Frauen ging mal so eine Maschine kaputt, es brach was ab oder bei der Tüte ging der Stift raus und dann mussten die Mechaniker kommen, ergänzt Frau St. Sie selbst wohnte damals in Karl-Marx-Stadt und da wurde sie gern geschickt, weil sie unabhängig vom Fahrdienst bei den Heimarbeiterinnen die Maschinen reparieren konnte, wenn es mal etwas länger dauerte. Sie berichtet von Frauen, die nervös wurden, wenn was nicht mit der Maschine klappte, denn der Auftrag musste ja fertig werden. Es war eine mentale Sache. So wollten die Frauen auch mal was loswerden, was Emotionales oder wollten wissen, was im Betrieb los war. Zu Hause waren sie abgeschottet und freuten sich über Neuigkeiten, über geplante Betriebsvergnügen.
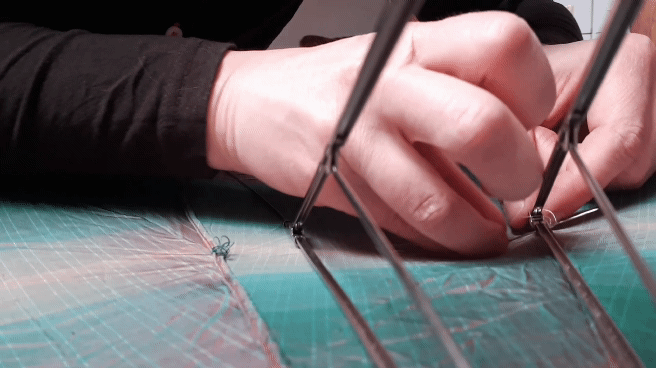
Frau Stritzke berichtet von Wohnungen, wo erst die Betten hochgeklappt werden mussten, damit Platz für die Nähmaschine war. Bei einer anderen Heimarbeiterin stand die Maschine im Schlafzimmer. Als Frau Stritzke zum Reparieren kam, lag der Ehemann, der Nachschicht hatte, noch im Bett und grüßte mit „Guten Morgen“. Sie hat auch Heimarbeiterinnen besucht, die auf dem Dorf in einem Haus wohnten. Die konnten bis in die Nacht hinein nähen, weil keine Nachbarn durch die Maschinengeräusche gestört wurden. In der Stadt in einem Neubau war das anders. Auch für Frau Stritzke war klar, ihr Sohn war fast ein Jahr, dass sie Heimarbeit machen wollte. Für die Nähmaschine hatte sie im Flur ihrer neu bezogenen Wohnung im größten Plattenbaugebiet von Karl-Marx-Stadt eine schöne Ecke. Drei Jahre nähte sie in Heimarbeit, bevor sie wieder im Betrieb als Nähmaschinenmechanikerin anfing. Sie fühlte sich als Außenseiterin – alle aus dem Block gingen zur Arbeit und sie war allein mit dem Kind zu Hause. Sie berichtet davon wie verlockend es war, sich die Zeit einteilen zu können, mal etwas länger zu schlafen, als wenn man früh halb sechs am Werksbus stehen musste. Man war aber auch auf sich gestellt, musste aufpassen, ob genug Zwirn und Ersatznadeln vorrätig waren, damit die fortlaufende Arbeit gewährleistet war. Frau Stritzke erzählt von einer großen Umstellung, von Einsamkeit. Sie war es gewohnt, immer viele Menschen um sich zu haben, sei es die große Familie aus Adorf oder die Kollegen aus der Fabrik. Heute hat man wenigstens ein Telefon, um sich austauschen zu können. Vor 50 Jahren hatte sie das noch nicht.
